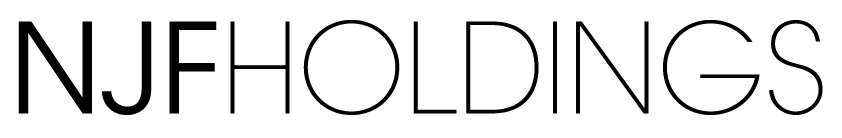„KI kann verstörend wirken“ – Investorin Junkermann über Fluch und Segen Künstlicher Intelligenz
Die erfahrene Risikokapitalgeberin spricht über ihre Investments im Gesundheitssektor, KI in der Medizin und finanzielles Engagement.
London Die groß gewachsene Frau mit dem langen blonden Haar spricht sechs Sprachen, trägt den Titel einer italienischen Gräfin, ist Mutter einer noch sehr jungen Tochter und wohnt im Londoner Stadtteil South Kensington. Nicole Junkermann ist in Düsseldorf geboren, in Spanien aufgewachsen, hat in Frankreich und Italien gelebt und reist beständig, am liebsten nach Asien.
Ihr erstes Geld hat die studierte Betriebswirtin mit einem Videospiel namens Winamax verdient – damals gab es nur eine Handvoll dieser heute so populären Animationen für virtuelle Hobby-Fußball-Manager. Erste Berufserfahrung im Konzern sammelte Nicole Junkermann als Assistentin der Geschäftsführung beim französischen Telekommunikationsanbieter Neuf Cegetel.
Danach leitete die fußballbegeisterte Anhängerin von Real Madrid gemeinsam mit dem ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus den TV-Lizenz-Vermarkter Infront, der unter anderem die Fernsehrechte an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hielt. Seit 2011 der Wettbewerber Bridgepoint für mehr als 500 Millionen Euro Infront kaufte, investiert Junkermann in ihren eigenen Fonds.
Frau Junkermann, das britische Gesundheitsministerium unter der Leitung von Matt Hancock hat Sie gerade in den wissenschaftlichen Beirat berufen. Warum?
Den Minister habe ich erstmals im Frühjahr dieses Jahres getroffen, als er noch das Technologie-Ressort verantwortete. Nach etwa zwei Monaten bekam ich dann einen Brief von ihm, in dem es hieß, er suche einen direkten Link zu jungen Unternehmen und zur Wissenschaft. Der Minister möchte mehr darüber erfahren, wie sich medizinische Innovationen schneller in das britische Gesundheitssystem und damit in den Alltag der Menschen transportieren lassen.
Wie wollen Sie ihm genau helfen?
Zunächst einmal: Das Interesse des Ministers freut und ehrt mich sehr. Mein Team und ich haben in den vergangenen Jahren einige Investments in Firmen aus dem Gesundheitssektor getätigt, bei den meisten geht es um Vorsorgeprodukte und Präventivtherapien. Der enge Austausch mit Gründern und Wissenschaftlern bringt uns viele Erfahrungen, etwa wie medizinischer Fortschritt schnellstmöglich aus dem Labor zum Patienten kommt.
Bitte etwas konkreter.
Überall da, wo sich in der Medizin beispielsweise künftig Künstliche Intelligenz einsetzen lässt, gibt es spannende Bezugspunkte. Wenn also KI die Verknüpfung von Patientendaten vornimmt und sich daraus Rückschlüsse für individualisierte Therapien in der Onkologie ableiten lassen, dann ist das für alle von Interesse: Patienten können rascher und punktgenauer behandelt werden. Den Pharmafirmen hilft es, wenn deren Produkte gezielter wirken: Und dem Gesundheitssystem nützt es, wenn die ohnehin teuren Behandlungen besser wirksam sind. Stark verkürzt gesagt, hilft das am Ende den Menschen und spart sogar Geld.
Klingt ein Stück weit idealistisch.
Finden Sie? Idealismus und wirtschaftliche Erwägungen schließen sich für mich eben gerade nicht aus. Das Besondere am Einsatz von KI in der Medizin ist ja, dass die neue Technologie sehr beschleunigend wirken kann, etwa bei der Zusammenstellung von Fokusgruppen in den klinischen Testphasen für neue Arzneien. Das spart schon bei der Entwicklung von Medikamenten und Therapien enorm viel Zeit und ist sehr effizient. Übrigens gilt das natürlich auch für sehr seltene, schwere Krankheiten, die heute leider bisweilen in der Forschung vernachlässigt werden, weil das als zu teuer und zu aufwendig gilt. Ich möchte dazu beitragen, dieses Dilemma zu lösen. Das kann nur gelingen, wenn die humanitären und geschäftlichen Erfolgsaussichten gleichgerichtet sind.
Sehen Sie den Einsatz von KI uneingeschränkt positiv?
Ganz sicher nicht. KI kann auch verstörend wirken und unserer Gesellschaft potenziell schaden, falls sich nicht endlich ein breites Bewusstsein dafür entwickelt, was wir von KI erwarten können und dürfen und wo vor allem auch die ethischen Grenzen von KI definiert werden. KI darf nicht die Menschen treiben. Umgekehrt müssen die Menschen KI entwickeln und klug anwenden. Dazu brauchen wir als Fundament eine Haltung und eine Kultur, ein belastbares Wertesystem. Im Moment setzen sich zu wenige berufene Menschen mit der Beantwortung dieser so zentralen Aufgabe auseinander.
Ein Beispiel, bitte …
Der Datenschutz: Patientendaten müssen uneingeschränkt geschützt sein! Die Würde und Integrität des Einzelnen darf nicht verletzt werden. Dass staatliche Stellen Millionen von Patientendaten an Pharmafirmen verkaufen wie in den USA, darf auf keinen Fall zum internationalen Standard werden. Diese Daten sind für den medizinischen Fortschritt wichtig, dürfen aber nur strikt zweckgebunden weitergegeben werden. Das passiert in den USA aber derzeit nicht. Hier braucht es sehr klar definierte Regeln und Grenzen.
Wenn sich durch KI womöglich auch bisher unheilbare Krankheiten besser behandeln lassen, geraten diese Bedenken dann nicht zwangsläufig in den Hintergrund?
Wir müssen die Möglichkeiten der Innovation nutzen, dürfen dabei jedoch nie unser Gewissen aufgeben. Die Menschen wollen nicht, dass die Technik ihr Leben frisst. Auf die Medizin bezogen heißt das: KI darf niemals und wird niemals den Arzt ersetzen, sondern soll nur dienend wirken. Das hat eine starke ethische Dimension. Wir müssen hier und heute die Werte identifizieren, die uns wichtig sind und diese Werte dann auch wenn nötig mit Überzeugung verteidigen.
as Bewusstsein dafür scheint noch nicht sehr weit verbreitet, wie sich im fahrlässigen Umgang mit Daten in den sozialen Medien leicht beobachten lässt.
So ist es. Die sozialen Medien sind oft das Gegenteil von sozial: Me, myself and I – alles dreht sich um das goldene Ich. Ich wage zu behaupten: Die Mehrheit der Nutzer von sozialen Medien interessiert sich weder für Politik noch für Gesellschaft. Wir müssen deshalb aufklären, aufklären, aufklären – da bin ich nicht zuletzt auch als Mutter gefragt. Die großen Tech-Konzerne wie Google und Alibaba werden sich niemals selbst regulieren oder gar beschränken. Auch das sollte uns sehr klar sein.
In wie vielen Unternehmen sind Sie inzwischen investiert?
Ich halte derzeit 24 Minderheitsbeteiligungen in zwölf Ländern. Alle diese Firmen verfolgen einen internationalen und skalierbaren Ansatz.
Beanspruchen Sie immer auch einen Platz im Board?
Das ist nicht zwingend. Unabhängig von einem Sitz im Board helfen wir vor allem in der Wachstumsphase bei der Kapitalbeschaffung, bei der Personalsuche und sind natürlich auch gerne strategischer Sparringspartner für das jeweilige Management. Übrigens sind manchmal auch die typisch deutschen Tugenden wie Ordnung und Struktur gefragt.
Und das machen Sie für alle 24 Unternehmen?
In unserem Team haben wir uns spezialisiert nach Branchen. Wobei ich mich persönlich vor allem mit dem Gesundheitssektor befasse.
In Deutschland sind Sie vor allem bei Optiopay investiert. Warum?
Weil mich neben der Geschäftsidee insbesondere auch immer die Persönlichkeit des Gründers interessiert, in diesem Fall Marcus Börner, ein Unternehmer mit Haltung und Kreativität.
Ich bin eindeutig langfristig orientiert, begleite die Investments im Schnitt über mehrere Jahre.
- Nicole Junkermann, Investorin
Optiopay gehört in die Klasse der Fintechs?
Genau. Wenn beispielsweise eine Versicherung im Schadensfall einen Betrag an den Kunden auszahlt, hat dieser mit Optiopay die Möglichkeit, das Geld statt per Überweisung auch in Form eines Gutscheins zu erhalten. Aus 100 Euro wird dann ein Gutscheinwert von vielleicht 120 Euro. Optiopay selbst reicht den Gutschein weiter und erhält eine Provision vom Onlineshop, der den Gutschein ausstellt. Optiopay teilt sich die Provision mit der Versicherung. Der Onlineshop profitiert, weil er einen neuen Kunden gewonnen hat.
Bei diesem Investment wie auch beim Berliner Start-up Rebuy, einem Online-Marktplatz für gebrauchte Elektronikprodukte, geht es jetzt aber ums bloße Geldverdienen – oder?
Was per se ja nicht verwerflich ist. Beide Geschäftsmodelle – das zeigen die Wachstumszahlen bei Optiopay und Rebuy – treffen offenbar den Nerv von Kunden. Und das freut auch mich als Investorin.
Ehemalige Beteiligungen von Ihnen waren Songza, Dollar Shave Club und RelatelQ, die Sie an Google, Unilever und Salesforce verkauft haben. Wann trennen Sie sich von Anteilen?
Immer dann, wenn eine Firma meine Hilfe nicht mehr braucht. Oder wenn wir uns gemeinsam mit anderen Investoren mehrheitlich für einen Exit entscheiden. Ich plane übrigens niemals beim Einstieg auch schon wieder meinen Ausstieg. Ich bin eindeutig langfristig orientiert, begleite die Investments im Schnitt über mehrere Jahre.
Das dürfte vor allem auch für Ihr Engagement bei der legendären Bildagentur und Fotografen-Kooperative Magnum gelten, wo Sie 2017 als erste externe Investorin Anteile erworben haben. Haben Ihnen die weltbekannten Fotos der Agentur, etwa von James Dean im Regen am Times Square, so imponiert?
Für mich waren das eher die historischen Aufnahmen vom Pekinger Tiananmen-Platz 1989, als die Welt einen Moment stillzustehen schien. Diese Fotos von Magnum haben bei mir als politisch interessierte junge Frau damals bleibenden Eindruck hinterlassen. Generell ziehe ich sehr viel Inspiration aus der Kunst und der Fotografie. Es eröffnen sich neue Perspektiven für anderes Denken. In den Werken der Künstler oder den Bildern der Fotografen spiegeln sich deren Haltungen. Die großen Magnum-Fotografen sind moderne Storyteller im besten Sinne des Wortes.
Und bei der Digitalisierung der Agentur können Sie womöglich auch helfen?
Vielleicht. Magnum gehört aber eindeutig in die Kategorie Leidenschaft und ist mir jenseits des finanziellen Investments emotional ans Herz gewachsen.
Frau Junkermann, herzlichen Dank für das Interview.
This article originally appeared on Handelsblatt.com